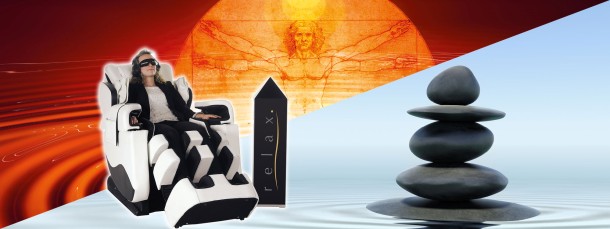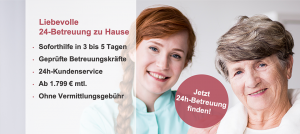Treppenlifte : Mobilität daheim bewahren
- -Aktualisiert am
Treppenlifte helfen, Barrieren im Alltag zu überwinden. Bild: thyssenkrupp Home Solutions
Die Menschen werden immer älter. Diese Entwicklung ist vor allem auf die immer besser werdende medizinische Versorgung und eine gesunden Lebensweise zurückzuführen.
Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass Selbstständigkeit und ein Leben in den „eigenen vier Wänden“ immer wichtiger werden. Eine steigende Lebenserwartung impliziert aber auch eine steigende Anzahl an pflegebedürftigen Menschen. Laut einer Prognose des Statistischen Bundesamtes wird es im Jahr 2020 knapp drei Millionen Menschen in Deutschland geben, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Mehr als 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Rund ein Drittel dieser Anzahl nimmt einen privaten Pflegedienst in Anspruch, die Mehrzahl wird von Angehörigen gepflegt. Ohne dieses weit gefächerte Angebot wäre es für viele Menschen nicht mehr möglich, in gewohnter Umgebung zu wohnen. Durch eine schwere Krankheit oder einen Unfall kann man innerhalb kürzester Zeit pflegebedürftig werden. Es wird also deutlich, wie wichtig häusliche Pflege und Pflegehilfsmittel sind, zum Beispiel Treppenlifte, und welchen Bestandteil sie noch in Zukunft haben werden.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Tritt ein Pflegefall ein, haben Pflegebedürftige und Angehörige die Wahl: Es besteht die Möglichkeit, Geldleistungen wie das Pflegegeld in Anspruch zu nehmen. Dieses wird von einem privaten Versicherungsunternehmen oder der Pflegekasse ausgezahlt. Eine weitere Lösung stellen sogenannte Pflegesachleistungen dar. Diese beinhalten beispielsweise Unterstützung durch ausgewählte ambulante Pflegedienste bis zu einer bestimmten Höchstgrenze. Weitere Angebote stellen verschiedene Unterstützungen im Alltag dar, die auf dem Wege der Kostenerstattung erfolgen können.
Was leisten ambulante Pflegedienste?
Die häusliche Pflege soll insbesondere die Möglichkeit schaffen, dass pflegebedürftige Menschen weiterhin in ihrem vertrauten Umfeld leben können. Außerdem wird somit die Koordination zwischen Beruf und Pflege für Angehörige erheblich erleichtert. Das Spektrum der häuslichen Pflege ist vielfältig und beinhaltet unter anderem:
- • Medizinische Behandlungspflege wie: Medikamentengabe, Injektionen, Verbandswechsel etc. (nach Sozialgesetzbuch § 37 SGB: Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung)
- • Hilfen bei der Haushaltsführung, darunter fallen unter anderem die Reinigung der Wohnung, Einkaufen und Kochen
- • Körperbezogene Pflegemaßnahmen, um den Pflegebedürftigen bei der Körperpflege, Ernährung und ausreichender Mobilität zu unterstützen
- • Ein Angebot von pflegerischen Betreuungsmaßnahmen soll helfen, soziale Kontakte aufrecht zu erhalten und bei der Gestaltung des Alltags zu bestärken
- • Außerdem bieten Pflegedienste eine umfassende Beratung für Pflegebedürftige und ihre Angehörige
Was sind ambulante Pflegesachleistungen?
Für pflegebedürftige Personen, die mindestens den Pflegegrad 2 aufweisen, werden Pflegesachleistung bis zu einer Höchstgrenze von der Pflegeversicherung bezuschusst. Eine Inanspruchnahme dieser Unterstützung setzt gewisse Vorgaben voraus. Demnach werden Leistungen des Pflegedienstes in Form von körperbezogenen Pflegemaßnahmen, Hilfen bei der Haushaltsführung sowie pflegerischen Betreuungsmaßnahmen bis zu einem gesetzlich vorgeschriebenen, monatlichen Höchstbetrag übernommen. Die Höhe der Unterstützung richtet sich nach dem Pflegegrad.
Welche Pflegegrade gibt es?
Seit dem 01.01.2017 wurden die bisherigen Pflegestufen (0 – 3) durch die neuen Pflegegrade (1-5) ersetzt. Dies wurde im Rahmen des zweiten Pflegestärkungsgesetztes (PSG II) entschieden. Grund dafür war in erster Linie eine verbesserte Chance auf Pflegeanspruch für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Darunter fallen Demenzkranke, längerfristig psychisch Erkrankte oder Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ziel ist es, diesen Menschen eine gleiche Pflegeleistung zusichern zu können wie körperlich beeinträchtigten Menschen.
- • Pflegegrad 1: Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- • Pflegegrad 2: Erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten
- • Pflegegrad 3: Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
- • Pflegegrad 4: Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
- • Pflegegrad 5: Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung
Wie wird die Pflegebedürftigkeit festgestellt?
Die Neuerungen des PSG II implizieren eine neue Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Demnach wird im Rahmen des NBA (Neues Begutachtungsassessment) beurteilt, wie selbstständig und in welchem Umfang Tätigkeiten ausgeübt werden können. Das Gutachten wird durch den MDK (medizinischer Dienst der Krankenversicherung) durchgeführt. Diese Bewertung erfolgt in einem Punktesystem, welches in sechs Module unterteilt ist:
- • Mobilität
- • Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
- • Verhaltensweisen und psychische Problemlage
- • Selbstversorgung
- • Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte
- • Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
Die Möglichkeiten im Rahmen der häuslichen Pflege sind vielfältig. Es bietet sich an, ein umfassendes Beratungsgespräch durch die Kranken- oder Pflegekasse in Anspruch zu nehmen. Des Weiteren sollten bei Inanspruchnahme eines Pflegedienstes Unsicherheiten im Vorfeld geklärt und verschiedene Varianten in Betracht gezogen werden.